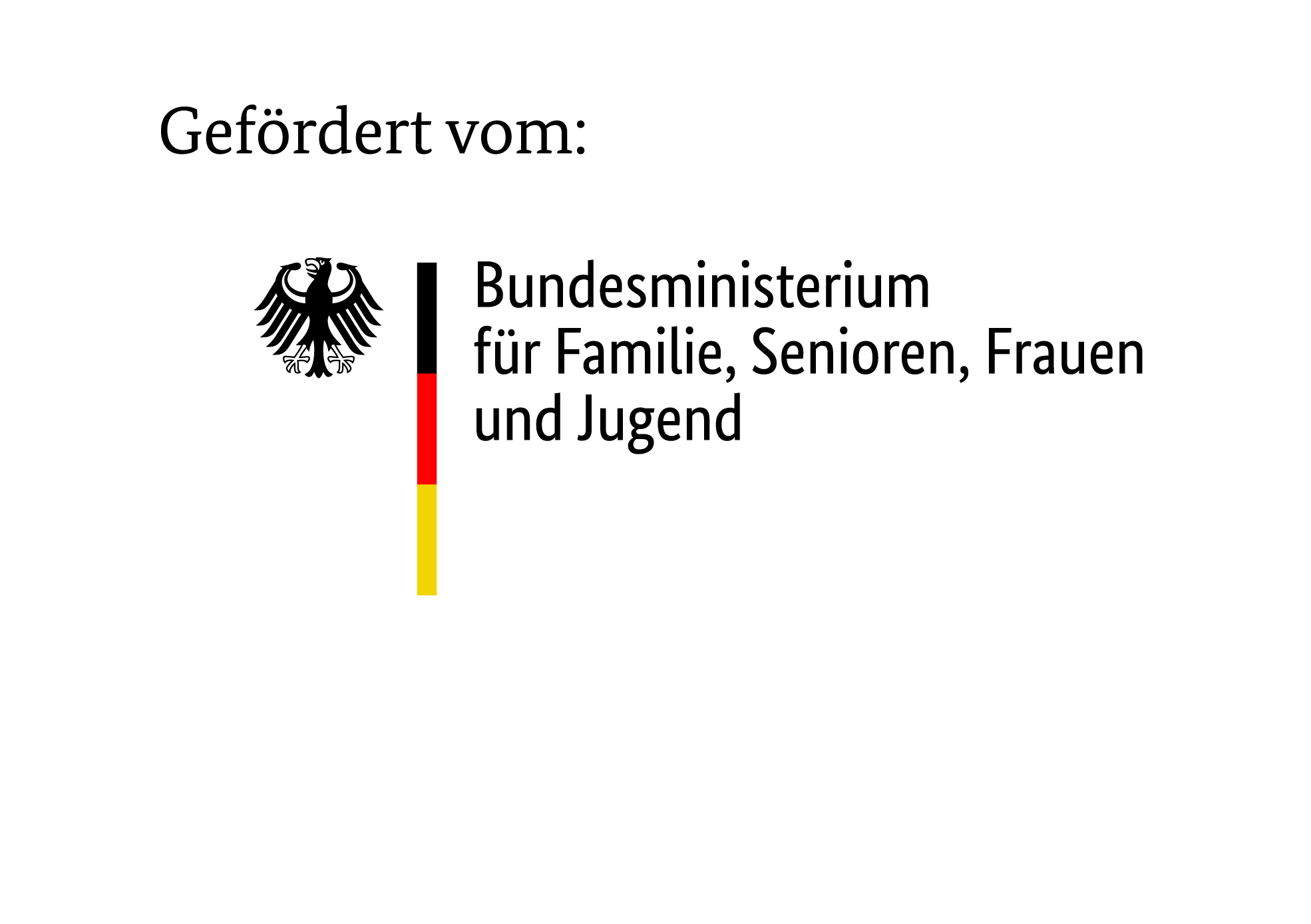Warten, bis der Therapeut kommt
Viele Patient*innen, viele Therapeut*innen, aber wochenlange Wartezeiten – warum gestaltet sich die Suche nach einem Therapieplatz in der Psychotherapie so schwer?

Kelly Sikkema – Unsplash
„Es ist utopisch – die Menschen brauchen jetzt Hilfe und nicht erst in einem Jahr“, sagt die Psychotherapeutin Anke Glaßmeyer mit Blick auf ihre Warteliste, die sie im vergangenen Juli geschlossen hat; freie Therapieplätze habe die 35-Jährige voraussichtlich erst wieder in einem Jahr.
Schon vor der Pandemie betrug die Wartezeit auf ein Erstgespräch in einer psychotherapeutischen Praxis mehrere Wochen – die seelischen Belastungen durch die Pandemie verschärfen das Problem daher umso mehr: Die Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung registriert im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich 40 Prozent mehr Patientenanfragen in den Praxen; bei den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen gingen sogar 60 Prozent mehr Anfragen ein. Die Zahl der Psychotherapeut*innen steigt hingegen seit Jahren kontinuierlich an, während die Wartezeiten noch immer wochenlang sind – was läuft also schief im System Psychotherapie?
„Es kann jeden treffen“
Auch Anke Glaßmeyer berichtet seit Beginn der Pandemie von häufigeren Anfragen in ihrer Praxis im westfälischen Ibbenbüren. „Jeder Mensch geht anders mit Krisen um“, betont sie, aber vor allem bei Menschen mit Vorbelastungen habe die Pandemie letztlich das „i-Tüpfelchen draufgesetzt“.
Anke Glaßmeyer. Bildunterschrift: Anke Glaßmeyer ist Psychotherapeutin für Erwachsene und betreibt eine Praxis im westfälischen Ibbenbüren. Bildnachweis: Anke Glaßmeyer
Etwa vier von zehn Deutschen erkranken im Laufe ihres Lebens an einer psychischen Erkrankung. Am häufigsten treten dabei Angststörungen, affektive Störungen und Störungen des Alkohol- oder Medikamentenkonsums auf. Jährlich sind in Deutschland 27,8 % der Erwachsenen von psychischen Erkrankungen betroffen – das entspricht etwa 18 Millionen Menschen. Jüngere Menschen zwischen 18 und 34 Jahren leiden mit 36,7 % sogar häufiger an psychischen Erkrankungen als der Durchschnitt. „Psychische Erkrankungen selektieren nicht nach dem Alter – es kann jeden treffen“, erklärt Anke Glaßmeyer. Sie behandelt in ihrer Praxis aktuell Betroffene zwischen 18 und 82 Jahren; der Großteil ist jedoch zwischen 20 und 45 Jahren alt.
Das lange Warten auf einen Therapieplatz
„Die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, haben zumeist schon einen hohen Leidensdruck“, berichtet sie und verweist auf die üblichen wochenlangen Wartezeiten auf einen Therapieplatz – ein Zeitraum, in dem sich die Symptome mitunter noch einmal verstärken könnten. Aus diesen Gründen gibt sie auf ihrer Homepage Tipps für die Suche nach einem Therapieplatz.
Im Jahr 2018 betrug die durchschnittliche Wartezeit auf ein Erstgespräch in einer psychotherapeutischen Praxis etwa sechs Wochen; bis zum Beginn der eigentlichen Therapie vergingen im Schnitt 19 Wochen. Anfang 2021 erhielten fast 60 % der Patient*innen innerhalb eines halben Jahres einen Behandlungsplatz in einer psychotherapeutischen Praxis; knapp 40 % mussten dafür jedoch länger als sechs Monate warten.
Die Vorpublikation einer Studie der Uni Leipzig und der Uni Koblenz-Landau belegt zudem gravierende Engpässe in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen: Durch die Pandemie sei die Wartezeit bis zum Therapiebeginn von dreieinhalb Monaten auf ein halbes Jahr angestiegen.
An Nachwuchs mangelt es nicht – aber an Kassensitzen
Das Psychologiestudium, das zu einer therapeutischen Tätigkeit führen kann, boomt indessen: Im Wintersemester 2019/2020 waren in Deutschland 91.000 Studierende der Psychologie eingeschrieben – knapp 30% mehr als noch fünf Jahre zuvor. Ebenso steigt die Zahl der Absolvierenden der Psychotherapie-Ausbildung und dementsprechend auch die Therapeutenzahl: Im Jahr 2019 arbeiteten 48.000 Psychotherapeut*innen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen in Deutschland – 19% mehr als noch fünf Jahre zuvor. 35.000 von ihnen arbeiten in einer Praxis, 25.000 davon haben einen sogenannten „Kassensitz“ und können somit die Behandlung mit den Krankenkassen abrechnen. Wer sich von Therapeut*innen ohne Kassenzulassung behandeln lässt, muss dagegen selbst für die Kosten aufkommen oder aufwendige Anträge bei der eigenen Krankenkasse stellen.
Die Zahl der Kassensitze ist in Deutschland allerdings limitiert: Ein Sitz kann erst dann wieder neu besetzt werden, wenn er vorher aufgegeben wurde. Dementsprechend hoch ist auch die Nachfrage nach diesen – fünfstellige Geldbeträge als Ablösesumme sind bei solchen Praxisabgaben daher keine Seltenheit mehr. Es kommen also keine neuen Praxissitze hinzu, sofern der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) seine Regularien nicht ändert. Der G-BA ist das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitssystem, das sich aus Vertreter*innen der Krankenkassen, Ärzteschaft, Krankenhäuser und Patient*innen zusammensetzt.
Ein Bedarfsplan, der die Realität nicht abbildet
Der G-BA wird gesetzlich damit beauftragt, durch Richtlinien festzulegen, welche Leistungen von den Krankenkassen übernommen werden und wie viele Ärzt*innen und Psychotherapeut*innen sich wo niederlassen dürfen. Durch eine komplizierte Berechnung entsteht so ein Bedarfsplan, laut dem in Deutschland jedoch viele Regionen mit Psychotherapeut*innen überversorgt sind.
Die Berechnung für den Bedarfsplan fand mit Inkrafttreten des Psychotherapeutengesetzes am 1. Januar 1999 statt: An diesem Tag war es für diese Berufsgruppe erstmals möglich, eine Kassenzulassung zu beantragen. Die Grundlage des Bedarfsplans waren zu diesem Zeitpunkt alle Psychotherapeut*innen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, die bis Ende August zugelassen waren – doch nicht alle, die vor dem Gesetz psychotherapeutisch tätig waren, konnten innerhalb dieses Zeitraumes eine Kassenzulassung erhalten. Schätzungsweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch etwa 5.000 Anträge im Verfahren. In den ostdeutschen Bundesländern befand sich die psychotherapeutische Versorgung zu diesem Zeitpunkt noch im Aufbau, was den Bedarfsplan zusätzlich verzerrte.
Ein jahrelanger Streit über die Anzahl der Kassensitze
Der G-BA wurde seitdem immer wieder gesetzlich damit beauftragt, den Bedarfsplan erneut anzupassen und gab dafür zuletzt ein Gutachten in Auftrag. Dieses wurde im Oktober 2018 vorgestellt und kam zu dem Ergebnis, dass für eine bedarfsgerechte Versorgung in der ambulanten Psychotherapie 2.400 neue Kassenzulassungen notwendig seien. In der vom G-BA verabschiedeten Reform der Bedarfsplanung im Mai 2019 waren dafür letztlich 776 neue Kassensitze vorgesehen – also etwa ein Drittel von dem, was empfohlen wurde.
Auf der Homepage des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) heißt es, Deutschland nehme „im internationalen Vergleich hinsichtlich des Umfangs der Versorgung und der Dichte an Psychotherapeuten in der Fläche eine Spitzenposition ein“. Es brauche „mehr Transparenz über die Anzahl freier Therapieplätze“, da die Praxen bislang nicht dazu verpflichtet seien, freie Kapazitäten bei den Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen zu melden.
Die Politik ist sich des Handlungsbedarfs bewusst
Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen), stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, hält die Entscheidung des G-BAs „für nicht nachvollziehbar“ und kennt die Diskussion um die Anzahl der Kassensitze: „Auch wenn rein wirtschaftliche Erwägungen in die Waagschale geworfen würden, ist es zu kurz gesprungen die notwendige Behandlung für psychisch kranke Menschen nicht zur Verfügung zu stellen, da eine chronifizierte psychische Krankheit nicht nur für die betroffene Person viel Leid bedeutet, sondern sowohl durch die Reduktion der Arbeitskraft als auch durch die Chronifizierung notwendig werdende Behandlungen, z. B. Klinikaufenthalte, ungleich teurer sind als eine Psychotherapie zur rechten Zeit.“
Kirsten Kappert-Gonther, MdB, Buendnis 90/Die Gruenen. Berlin, 12.09.2019. Copyright: Thomas Trutschel/ photothek.net
Auch wenn die Schaffung von mehr Kassensitzen auch mit mehr Geld verbunden sei, sei es notwendig, um die Wartezeiten zu verringern. Damit würden Betroffene schneller psychotherapeutische Unterstützung erhalten, wodurch wiederum Kosten eingespart werden könnten: Allein die direkten Kosten, die im Gesundheitssystem durch psychische Erkrankungen entstehen, liegen jährlich bei 44,4 Milliarden Euro – damit sind sie die zweitteuerste Erkrankungsgruppe nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Berechnet man auch die Kosten mit ein, die beispielsweise durch Produktionsausfälle infolge von Arbeitsunfähigkeit oder durch Frühverrentungen entstehen, liegen die Gesamtkosten in Deutschland mit steigender Tendenz bei 147 Milliarden Euro pro Jahr. Dr. Kirsten Kappert-Gonther sei froh, dass im Koalitionsvertrag explizit eine Reform der Bedarfsplanung erwähnt wird. Außerdem fordert sie eine verbindlichere Vernetzung der psychosozialen Hilfestrukturen, um die Versorgung schwer und chronisch psychisch Kranker sicherstellen zu können. Aufgrund der aktuellen Krisen sei noch mit einem zusätzlichen Anstieg des Bedarfs an Psychotherapie zu rechnen. Deshalb fordert sie niedrigschwellige Beratungsangebote für Schulen und Universitäten, Sonderbedarfszulassungen sowie eine schnellere und leichtere Kostenübernahme der Therapie in einer Privatpraxis. Gerade Letzteres ist durch eine Überarbeitung der Psychotherapie-Richtlinie im Jahr 2017 zunehmend schwieriger geworden.
Eine Reform, die Veränderung bringen sollte
Die Reform sollte den Zugang zu Psychotherapeut*innen erleichtern: Seitdem gibt es die Akutbehandlung für besonders dringende Fälle, die psychotherapeutische Sprechstunde und Vorgaben zur telefonischen Erreichbarkeit der Praxen.
„Grundsätzlich ist es gut, dass die Patient*innen kurzfristig in den Sprechstunden alles abklären können. Allerdings ist die Reform nicht so ganz durchdacht“, bemängelt Anke Glaßmeyer. Ihre Praxis muss wöchentlich für 100 Minuten telefonisch erreichbar sein und sie muss 50 Minuten Sprechstunde anbieten. Letztlich fehle dadurch eben Zeit für die Therapie – sie schätzt, dass sie durch den Zeitaufwand etwa einen Therapieplatz weniger anbieten könne. Während sich die Wartezeiten auf ein Erstgespräch durch die Reform verringerten, mussten Betroffene im Schnitt vier Wochen länger auf den Therapiebeginn warten.
Außerdem wurden Terminservicestellen eingerichtet, worüber den Versicherten Termine in einer Praxis für Psychotherapie vermittelt werden können. Die Versicherten können über dieses Angebot einen Termin für ein Erstgespräch vermittelt bekommen. Allerdings können einige Praxen danach keine weiterführende Therapie anbieten – durch die Reform haben sich die Behandlungskapazitäten nämlich nicht erhöht. Doch das Angebot der Terminservicestellen scheint seit der Reform eine der Begründungen dafür zu sein, weshalb die Krankenkassen immer häufiger Anträge auf Kostenerstattung ablehnen.
Eine Alternative, bei der sich Durchhaltevermögen lohnt
Grundsätzlich sind die Krankenkassen gesetzlich dazu verpflichtet, die Kosten einer Psychotherapie in einer Privatpraxis zu übernehmen, wenn kein Therapieplatz bei Psychotherapeut*innen mit Kassenzulassung zur Verfügung steht. Dafür müssen umfangreiche Anträge bei den Kassen gestellt werden – seit der Reform von 2017 werden jedoch deutlich mehr davon abgelehnt: Wurden im Jahr 2016 noch etwa 80 Prozent der Anträge bewilligt, war es 2017 nur noch knapp die Hälfte aller Anträge. Die Krankenkassen müssen seit dem Jahr 2013 dazu keine offiziellen Zahlen mehr offenlegen und hätten dadurch die Möglichkeit, lange Wartezeiten und fehlende Therapieplätze als Einzelfälle darzustellen.
„Die Kassen stehlen sich hier nach unserer Einschätzung aus der Verantwortung“, schreibt die Initiative „Kassenwatch“ auf Anfrage. „Kassenwatch“ bietet eine interaktive Datenbank, über die sich Psychotherapeut*innen über Komplikationen in Bezug auf das Kostenerstattungsverfahren austauschen und gegenseitig unterstützen können. Die Plattform des Berufsverbands der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT-BV), die von der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Dr. Felicitas Bergmann initiiert wurde, möchte dadurch die Missstände in der Kostenerstattung aufdecken. „Wir sehen Kassenwatch in Bezug auf die Kostenerstattung jedoch als ein Projekt auf Zeit, dessen Ziel darin besteht, sich selbst überflüssig zu machen, indem die Bedarfsplanung tatsächlich irgendwann dem realen Bedarf der Patient*innen entspricht.“
Auf Kosten der Betroffenen
Doch der Weg dorthin ist alles andere als einfach. Die Begründungen der Krankenkassen, weshalb sie solche Anträge ablehnen, seien vielfältig: Seit der Reform würden die Versicherten immer wieder auf die Terminservicestellen verwiesen, auch wenn sie dort bereits mehrfach angerufen oder auch schon Sprechstundentermine wahrgenommen hätten. Häufig heiße es vonseiten der Kassen, dass es genügend Kassenplätze mit zumutbaren Wartezeiten oder gar keine Kostenerstattung mehr gebe. „Wir beobachten auch, dass diese Ablehnungen so geschickt formuliert sind, dass bei den Versicherten der Eindruck entstehen muss, dass die Kostenerstattung rechtlich nicht möglich ist. Die Umstände, unter denen Versicherte sehr wohl einen Anspruch auf eine Erstattung haben, bleiben unerwähnt.“
Interne Auswertungen der von der Initiative bearbeiteten Fälle zeigen, dass zwei Drittel der zuvor abgelehnten Anträge später doch durch die Krankenkassen bewilligt worden seien. „Es lohnt sich, hartnäckig zu bleiben, und die Kassen mithilfe eines rechtssicheren Vorgehens dazu zu bewegen, geltendes Recht auch umzusetzen“, schreibt „Kassenwatch“.
„Diesen Ärger wollte ich mir und den Patienten nicht antun“
Anke Glaßmeyer führte von Anfang des Jahres 2019 bis Mitte 2021 eine Praxis, in der sie lediglich Privatversicherte und Selbstzahler*innen behandelt hat, bis sie einen Kassensitz erwarb. In dieser Zeit hat sie sich dagegen entschieden, auch gesetzlich Versicherte über die Möglichkeit der Kostenerstattung zu behandeln: Ein großer bürokratischer Aufwand, hohe Ablehnungsquoten und die zusätzliche Belastung der Patient*innen durch die Verfahren waren Aspekte, die für sie dagegensprachen. Da ihre Praxis im Umkreis eine der wenigen Privatpraxen war, konnte sie auch ohne die Kostenerstattung leben – bei Kolleg*innen in Großstädten sei das jedoch deutlich schwieriger.
Umso wichtiger sei daher die Schaffung von mehr Kassensitzen durch eine erneute Überarbeitung des Bedarfsplans, eine Vereinfachung der Antragsverfahren auf Kostenerstattung, aber auch mehr Vorsorge, Aufklärung und Prävention. Das sieht auch Dr. Kirsten Kappert-Gonther so: „Ich wünsche mir, dass schon in den Schulen mehr Wissen über seelische Gesundheit vermittelt wird, dass am Arbeitsplatz Gesundheitsförderung und Prävention einen größeren Stellenwert erhalten und dass die Vernetzung im Hilfesystem verbindlicher gestaltet wird, damit, wer krank ist, auch die Hilfe bekommt, die er oder sie braucht.“